[jpg] Der Grimme Preis als deutscher Qualitätsmaßstab des Jahres. Die Grimme Preise von 2013 waren im Vorfeld durch die Nominierung von Dschungelcamp (RTL) in eine Diskussion über die Qualität der Preise gekommen. Am 27. März 2013 wurden in Düsseldorf die Preisträger benannt, die am 12. April 2013 durch das Grimme Institut im Theater der Stadt Marl den begehrten Preis erhalten werden. Die Pressekonferenz fand in Düsseldorf in den Räumlichkeiten des lfm-Institutes [ Landesanstalt für Medien ] statt.
| Moderiert wird die Preisgala wie im vorigen Jahr von Michael Steinbrecher. Es kam die Nominierung des Dschungelcamp zur Rede, die auf dieser Pressekonferenz nicht erklärbar war.
Dschungelcamp wäre zwar handwerklich eine gute Sendung, jedoch reiche nur handwerklich nicht für einen Preis aus. Dschungelcamp ist ein „Agenda 2010“ Format, welches zeigt, wozu sich Menschen heute hergeben müssen – „Jeder Job ist zumutbar“
Es ist im Neuhochdeutsch ein sogenanntes Trashformat, wie so vieles in den Sendern und ziele auf den schlechten Geschmack der Menschen ab. |
|

Michael Steinbrecher |
| |

v.l.: Die Sieger – Claudia Michelsen, Bettina Braun, Max Giermann und Michael Steinbrecher (Moderator) |
|
Wir wollen uns jedoch nicht von den Randergebnissen beeinflussen lassen und uns den Preisträgern 2013 zuwenden. Insgesamt wurde durch das Institut eine Steigerung der Qualität deutscher Fernsehproduktionen festgestellt. Diese zeigen eine sehr große Nähe zum Menschen und fielen durch ihre Sorgfältigkeit auf. Uwe Kammann, Direktor des Grimme Instituts fielen auch die starken zeitgeschichtlichen Bezüge auf, die bis in die Unterhaltung gingen.
Die Entscheidungen für den 49. Grimme – Preis 2013 im einzelnen ( Rezensionen nach Aufzählung der Preisträger ):
Wettbewerb Fiktion / Spezial
Grimme-Preis
an
Dorothee Schön (Buch)
Johannes Fabrick (Regie)
Wotan Wilke Möhring (stellv. für das Ensemble)
für
Der letzte schöne Tag (WDR)
Produktion: hager moss film
Grimme-Preis
an
Magnus Vattrodt (Buch)
Matti Geschonneck (Regie)
Ina Weisse, Barbara Auer (Darstellung)
für
Das Ende einer Nacht (ZDF)
Produktion: Network Movie
Grimme-Preis
an
Jochen Bitzer (Buch)
Stephan Wagner (Regie)
Robert Atzorn (stellv. für das Ensemble)
für
Der Fall Jakob von Metzler (ZDF)
Produktion: teamWorx
Grimme-Preis
an
Thomas Kirchner (Buch)
Christian Schwochow (Regie)
Lars Lange (Ausstattung)
Jan Josef Liefers, Claudia Michelsen, Sebastian Urzendowsky (stellv. für das Ensemble)
für
Der Turm (MDR/Degeto/BR/NDR/WDR/SWR/rbb)
Produktion: teamWorx
Grimme-Preis „Spezial“
an
Anke Greifeneder (Redaktion/Produktion)
Quirin Berg (Produktion)
Tobi Baumann (Regie)
Sebastian Wehlings (Buch)
Christian Lyra (Buch)
für die Idee und Konzeption des Formats
„Add a friend“ (TNT Serie)
Produktion: Wiedemann & Berg Film
| |

Vom Grimme-Institut v. lks: Henning Severin (Pressesprecher) , Direktor Uwe Kammann, Dr. Ulrich Spies |
|
Wettbewerb Information und Kultur / Spezial
Grimme-Preis
an
Thomas Riedelsheimer (Buch/Regie/Kamera/Schnitt)
für
Seelenvögel (WDR)
Produktion: Filmpunkt
Grimme-Preis
an
Eric Friedler (Buch/Regie)
für
Ein deutscher Boxer (NDR/SWR)
Produktion: NDR
Grimme-Preis
an
Annekatrin Hendel (Buch/Regie)
für
Vaterlandsverräter (ZDF/ARTE)
Produktion: It Works! Medien
Grimme-Preis
an
Andreï Nekrasov, György Dalos (Buch)
Christian Beetz (Produktion)
Georg Tschurtschenthaler (Produktion)
für
Lebt wohl, Genossen! (ZDF/ARTE/rbb)
Produktion: Gebrueder Beetz Filmproduktion, Artline Films
Grimme-Preis „Spezial“
an
Bettina Braun (Buch/Regie/Kamera/Schnitt/Produktion)
für
die filmische Langzeitbeobachtung in der Dokumentar-Trilogie
„Was lebst du? – Was du willst – Wo stehst du?“ (ZDF)
Produktion: B’Braun Filmproduktion, ICON Film
Wettbewerb Unterhaltung / Spezial
Grimme-Preis
an
Mizzi Meyer (Buch)
Arne Feldhusen (Regie)
Bjarne Mädel (Darsteller)
für
Der Tatortreiniger – Schottys Kampf (NDR)
Produktion: Nordfilm
Grimme-Preis
an
Martin Brindöpke, Markus Hennig (Buch)
Dirk Nabersberg (Regie)
Sarah Wirtz (Maske)
Max Giermann (stellv. für das Ensemble)
für
Switch Reloaded – ‚Wetten dass..?’ -Spezial (ProSieben)
Produktion: Eyeworks Germany
Die Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbandes
für Verdienste um die Entwicklung des Fernsehens
wird vergeben
an
Matti Geschonneck
| |

Die Juroren: Anette Borkel, Gerd Hallenberger und Fritz Wolf
|
|
Der Sonderpreis Kultur des Landes NRW
wird vergeben
an
Shaheen Dill-Riaz (Buch/Regie)
für
Fremde Kinder: Der Vorführer (ZDF/3sat)
Produktion: Mayalok Filmproduktion
Der Publikumspreis der Marler Gruppe
wird vergeben
an
Beate Langmaack (Buch)
Rainer Kaufmann (Regie)
Devid Striesow, Stipe Erceg (Darstellung)
für
Blaubeerblau (BR/MDR/Degeto)
Produktion: Polyphon Film & Fernsehgesellschaft, Moviepool
Das Eberhard-Fechner-Förderstipendium der VG Bild-Kunst
wird vergeben
an
Jan Schomburg (Buch/Regie)
für
Über uns das All (WDR)
Produktion: PANDORA Film

Claudia Michelsen |
|
Anwesend waren Claudia Michelsen für das Ensemble „Der Turm“ (MDR/Degeto/BR/NDR/WDR/SWR/rbb), Max Giermann für das Ensemble „Switch Reloaded – ‚Wetten dass..?’ -Spezial“ (Pro Sieben) sowie Bettina Braun für „Was lebst du? – Was du willst – Wo stehst du?“ (ZDF).
Stellvertretend für alle Preisträger wollen wir die drei Produktionen besprechen die durch ein Mitglied aus dem Ensemble auf der Pressekonferenz vertreten waren. Alle drei Künstler sind mehrfach ausgezeichnet und gehören zu dem Besten was Deutschland zu bieten hat. |
So spielte Claudia Michelsen in dem Zweiteiler „Der Turm“ die Mutter Anne Hoffmann. Diese eindrucksvolle Literaturverfilmung ist ein gutes Beispiel für eine gelungene Umsetzung der 1000 seitigen Vorlage des gleichnamigen Romans von Uwe Tellkamp. Im Dresden des Jahres 1982 leben in einem Bildungsbürgertum, welches es nicht in einem Arbeiter- und Bauerstaat geben kann, Anne ( Claudia Michelsen ) und Richard Hoffmann ( Jan Josef Liefers ). Er, leitender Chirurg, hat mit seiner Sekretärin zwei Kinder, zu denen er sich jedoch nicht bekennt, weil dies seiner Karriere nicht förderlich ist. Mit seiner Frau Anne hat er ein Kind – Christian, welcher mal in seine Fußstapfen treten soll. Es ist das Thema von Anpassung, Kampf der Generationen, Aufbegehren aber auch subtiler Kampf gegen ein Regime, welches seine Mitglieder mittels einer Unterdrückungsmaschinerie gefügig hält. Es ist aber auch in der dargestellten Zeit ein sterbender Staat, welcher unfähig ist sich zu reformieren. Gefangen in diesem Regime spielt die Familie ein Spiel zwischen Familienglück und dem Kampf um die Positionen in dieser Gesellschaft. Das Regime dient allen als Korsett, welches allen irgendwie einen Halt gibt. Dieser Halt stellt sich jedoch als Widerspruch heraus, der in auftretenden Krisen nicht belastbar ist. Das Regime zerbricht an diesem Widerspruch und damit zerbrechen auch die Familienbande. Am Schluß des Filmes nimmt der Sohn der Hoffmanns, Christian ( Sebastian Urzendowsky ) , sein Leben in die eigene Hände. Die Zwänge sind durchbrochen weil die immer wieder aufgezeigten Gemeinsamkeiten nie bestanden hatten.
Frau Michelsen, selber gebürtige Dresdnerin, fand im Interview den Film in seiner Fiktion als gelungen. Die städtebaulichen Aspekte seien allerdings etwas anders aufgebaut und heute so gar nicht mehr wieder zu erkennen.
| Seit Jahren gibt es die Parodie „Switch Reloaded“ (ProSieben) mit großem Erfolg. Ist diese Sendung doch ein intelligenter aber auch hintergründiger Anschlag auf unsere Möglichkeit Humor zu erkennen und darüber zu lachen. Mit „Switch Reloaded -,Wetten, dass..? – Spezial“ ist dem Ensemble eine Steigerung ihrer liebenswerten Boshaftigkeiten gelungen. Max Gierman als Markus Lanz und Bernhard Hoëcker als Thomas Gottschalk tun das wozu die Originale in ihrer Sendung Wetten, dass..? nicht mehr in der Lage sind, dass Publikum zu unterhalten. |
|

Max Giermann |
Es ist aber auch eine schonungslose Kritik, die die Schwächen des Unterhaltungssektors des etablierten „Staatsfernsehens“ aufdeckt. Wo Unterhaltung drauf steht, ist nicht immer Unterhaltung drin, so könnte man die Originale bezeichnen. So nehmen Max Giermann und Bernhard Hoëcker gnadenlos die „Premiere“ der Sendung „Wetten,dass..?“ mit Markus Lanz aufs Korn, aber nicht ohne eine Hintertür, die auf eine bessere Sendung jenseits einer Katzenmütze für Tom Hanks setzt. Es ist die Möglichkeit der Glaubwürdigkeit, der man sich in dieser Sendung immer wieder ausgesetzt fühlt und dies hält einen an dieser Sendung – die Fernbedienung bleibt liegen. Die Sendung ist aber auch nicht eine Kritik gegen das Fernsehen, vielmehr ist es eine Aufforderung zu einem besserem Fernsehen jenseits von eingeübten immer wiederkehrender Mechanismen.

Bettina Braun |
|
„Was lebst du? – Was du willst – Wo stehst du?“ (ZDF)von Bettina Braun stellt eine gelungene dreiteilige filmische Dokumentation von Menschen mit Migrationshintergrund dar.
Bettina Braun begleitet drei junge Männer, Ali,Kais und Alban, mit ihrem sozialen Umfeld in Köln ab dem Jahre 2004 bis zum Jahre 2012.
Kulturell haben alle drei ihre Wurzeln in der muslimischen Kultur, suchen aber ihren Platz in der deutschen Kultur. Bettina Braun geht hier sehr sensibel mit den Jugendlichen um, sie registriert und geht mit dem Registrierten auf eine allgemein verständliche Ebene. |
Braun bedient dabei nicht irgendein übliches Klischee, vielmehr begleitet sie die jungen Menschen auf ihrem Weg in die Erwachsenenwelt.
Tatsächlich könnten diese Drei auch Deutsche sein, es würde jedoch das Ganze zu sehr vereinfachen. Alle drei versuchen sich in den beiden Welten zu arrangieren und die in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Da sind die Träume der drei, die – für Jugendliche normal – nicht schnell genug umgesetzt werden können. Braun überschreitet die Grenzen des Beobachters und wird durch ihre Teilhabe selber Teil der Szene. Als sie schwanger ist nehmen die drei Jugendlichen liebevoll an der Schwangerschaft teil. Und als das Kind auf der Welt ist, hat das Kind auf einmal drei Väter oder Brüder, die es in ihren Kreis aufnehmen. So wird die gegenseitige Fremdheit von Kamera und Objekt aufgehoben und scheint im Schlußteil (Wo stehst du?) fast zu einem Familentreffen. Braun verlässt jedoch nie die Thematik, wie Jugendarbeitslosigkeit oder Multikulturalität, sensitiv führt sie den Betrachter in eine zukünftige Welt, die er jenseits der Zerrissenheit unserer heutigen Zeit neu erschließen könnte. Es ist das Persönliche und Emotionale welches dieser anderen Welt anhaftet.
Es gibt aber noch etwas, was unbedingt erwähnt werden sollte. So wird das Grimme Institut zum dritten male im Rahmen der Preisverleihung eine Versteigerung zu Gunsten des Kinderhospizdienstes Recklinghausen durch führen. Zwei Eintrittskarten für die Galaverleihung im Theater Marl sowie ein Meet & Greet für den guten Zweck wird es mit dem Grimme Preisträger Devid Striesow („Blaubeerblau“) geben. Die Auktion wird von United Charity unterstützt. Internetnutzer können auf der Webseite www.unitescharity.de bis zum 9. April 2013 bis 17:30 Uhr, mitbieten. Wir wollen schnell und unbürokratisch Gutes tun, so Grimme Direktor Uwe Kammann. Sterben und Tod von Kindern soll mit der Unterstützung prominenter und renommierter Menschen und Institutionen enttabuisiert werden.
Aus dem sehr großen Angebot fiel diesmal die Enttabuisierung mit dem Thema: Tod und Sterben auf. Hier sei auf die ARD verwiesen die mit diesem Thema in einer Sterbewoche das erste Eis brach und mit Dokumentarischem dem Zuschauer die Sichtweise öffnete. Im Bereich Fernsehjournalismus konnte nichts herausragendes und preiswürdiges erkannt werden.
EN-Mosaik findet in Zeiten wo wir uns als Europäer begreifen, das französische Format 28‘ auf Arte, französisch mit deutschen Untertiteln, als ein preiswürdiges Format. Von Montag bis Freitag setzt sich Elisabeth Quin, gemeinsam mit den Journalisten Renaud Dély und Nadia Daam, mit tagesaktuellen Ereignissen auseinander: für „28 Minuten heute“ empfangen Elisabeth Quin mit ihren Kollegen einen, und für das „Thema des Tages“ zwei bzw. drei Studiogäste. Diese informelle Sendung könnte unseren deutschen Dampfplauderen von Anne Will bis Frank Plasberg als Blaupause dienen.
Claudia Michelsen meinte dann auch im Gespräch, das Publikum wird permanent und konstant falsch behandelt und unterschätzt. So sind die Sendungen und Formate die sehenswert sind in der Regel zu später Stunde jenseits von 23:00 Uhr zu sehen. Daraus entsteht der Wunsch in der Hauptzeit (Primetime) mehr relevantes sehen zu wollen. Grimmepreisträger sind keine Exoten, vielmehr sind sie die gute Normalität schlechthin, die den Zuschauer anspricht und ihn das gibt was er will, nicht was die Quote will (Was auch immer das sein wird).
Jürgen Gerhardt für EN-Mosaik aus Düsseldorf
[Alle Fotos: © Linde Arndt]

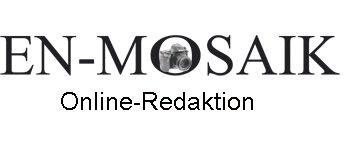

 [5. September 2013, Essen]
[5. September 2013, Essen]






![Dina Nur o.T. Stahl und Kunststein [2] Dina Nur o.T. Stahl und Kunststein [2]](https://en-mosaik.de/wp-content/gallery/dina/thumbs/thumbs_blick1.jpg)
![Dina Nur o.T. Stahl und Kunststein [1] Dina Nur o.T. Stahl und Kunststein [1]](https://en-mosaik.de/wp-content/gallery/dina/thumbs/thumbs_blick2.jpg)
















